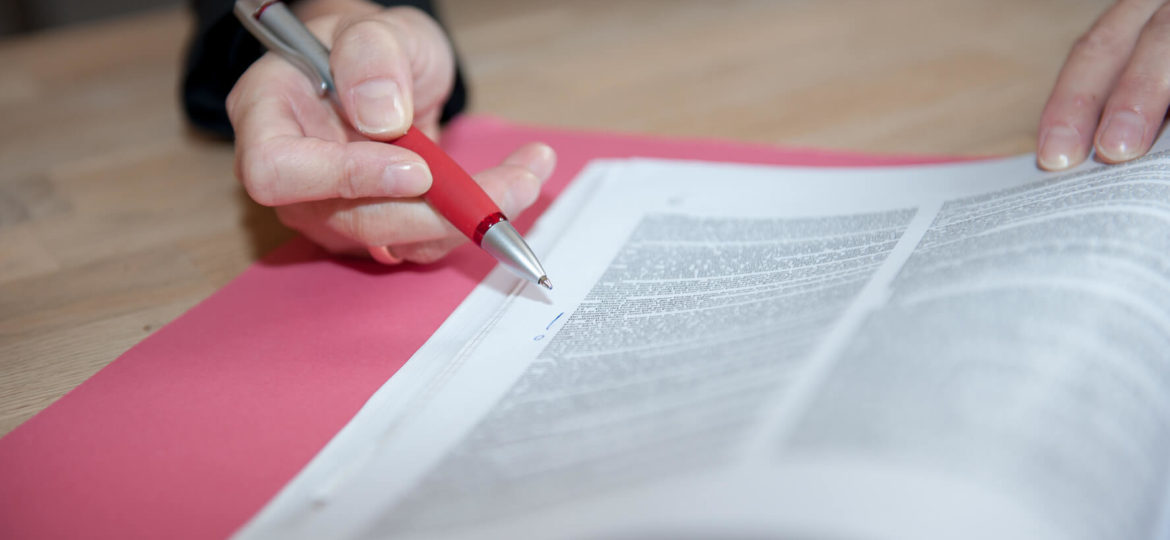
Stellen Sie sich vor, Sie verkaufen ein brandneues Elektroauto über Ihren modernen Webshop. Der Kunde bestellt – alles läuft gut. Doch ca. ein Jahr später trudelt der Widerruf des Vertrages ein. Das Auto? Zahlreiche Kilometer auf dem Tacho – optisch und technisch definitiv nicht mehr „Showroom“.
Sie denken: „Na gut, wenigstens bekomme ich Wertersatz für die Nutzung.“
Aber leider kann das auch schiefgehen.
Denn genau mit so einem Sachverhalt hatte sich das OLG Stuttgart in seinem Urteil vom 8. April 2025 (Az. 6 U 126/24 https://www.landesrecht-bw.de/bsbw/document/NJRE001605413 ) zu beschäftigen. Und das ist besonders brisant für den Onlinehandel – nicht nur für Autoverkäufer.
Eine fast perfekte Widerrufsbelehrung kann eben auch mal nicht gut genug sein und sehr teuer sein.
Der Fall: Elektromobilität trifft Paragraphen
Ein Händler verkaufte ein Elektrofahrzeug online. Der Vertrag wird im Rahmen eines Fernabsatzvertrages geschlossen – der Verbraucher kauft also „auf Distanz“, inklusive gesetzlichem Widerrufsrecht.
Der Händler belehrt den Käufer auch über dieses Recht – und zwar mit einer Widerrufsbelehrung, die dem gesetzlichen Muster auffallend nahe kommt.
Aber: Am Anfang der Belehrung stehen mittunter zwei rechtliche Begriffe, die für Verbraucher unklar bleiben – und vor allem nicht weiter erklärt werden.
Ergebnis: Aus Sicht des OLG kein klar verständlicher Beginn, keine transparente Belehrung – damit wird die gesetzliche Widerrufsfrist von 14 Tagen nicht in Gang gesetzt – die absolute Ausschlussfrist von 12 Monaten und 14 Tagen kommt zur Anwendung, war aber im konkreten Fall noch nicht abgelaufen.
Ein Jahr später – der Widerruf.
Und dann: Rückgabe des Fahrzeugs, diverse Gebrauchsspuren und bereits hohe Kilometerleistung.
Der Streit: Muss der Verbraucher für den Wertverlust des Fahrzeuges zahlen?
Der Händler verlangt Wertersatz für den Wertverlust des Fahrzeugs. Schließlich war dieses zwischenzeitlich kein Ausstellungsstück mehr.
Das OLG sagt:
Kein Wertersatz – jedenfalls nicht nach § 357a BGB. Und das gleich doppelt:
- Nicht für die Verschlechterung der Ware vor dem Widerruf
- Und auch nicht für den Zeitraum zwischen Widerruf und tatsächlicher Rückgabe
Warum?
Weil die Widerrufsbelehrung eben gerade nicht dem gesetzlichen Muster entsprach und für den Verbraucher unverständliche Inhalte hatte – was zur Folge hat, dass die gesetzliche Widerrufsfrist von 14 Tagen nie zu laufen begonnen hat.
Der Händler hatte sich also selbst – wenn auch unbeabsichtigt – „um den Wertersatz gebracht“.
Warum reicht „fast korrekt“ nicht?
Das OLG legt hier die Latte für „transparente Verbraucherbelehrung“ recht hoch: Schon das Verwenden zweier juristischer Begriffe („Verbraucher“, Vertrag unter Verwendung Fernkommunikationsmittel“) am Anfang der Widerrufsbelehrung – ohne weitere Erklärung – machte aus Sicht der Richter das Ganze unklar für den durchschnittlichen Verbraucher, also nicht mehr „klar und verständlich“ im Sinne des Gesetzes – und damit war die Belehrung unwirksam.
Für die Praxis heißt das:
Selbst kleinste Abweichungen vom gesetzlichen Muster können die Belehrung unwirksam machen – auch wenn sie juristisch korrekt gemeint sind.
Ein Lichtblick für Händler: Trotz Entfallen des Wertersatzes aufgrund fehlerhafter Widerrufsbelehrung betont das OLG auch:
Verbraucher haben während der Zeit zwischen Lieferung und Rückgabe bestimmte Obhuts- und Sorgfaltspflichten gegenüber der Ware – auch ohne formell laufende Widerrufsfrist.
Wenn diese grob verletzt werden (z. B. Schäden durch unsachgemäße Nutzung oder Vernachlässigung), kann dem Händler wegen Verletzung von Obhutspflichten ein Schadensersatzanspruch zustehen – außerhalb des § 357a, über § 280 BGB.
Händler-Checkliste nach dem Urteil – So machen Sie es besser:
1. Nutzen Sie das gesetzliche Muster für die Widerrufsbelehrung – und zwar wortwörtlich.
Abweichungen, juristische Fachsprache oder kreative Anpassungen sind (leider) keine gute Idee.
2. Verstehen Sie „Transparenz“ wie ein Verbraucher – nicht wie ein Jurist.
Was für Fachbereiche logisch klingt, kann für den juristisch ungebildeten Verbraucher (oder ein dies bewertendes Gericht) vollkommen unverständlich sein.
3. Dokumentieren Sie Zustand und Rückgabeprozess – besonders bei teuren Produkten wie Fahrzeugen oder Elektronik.
4. Weisen Sie Kunden freundlich, aber deutlich auf Ihre Obhutserwartungen hin (z. B. im Rahmen der AGB oder in separaten Hinweisen).
5. Lassen Sie Ihre AGB und Widerrufsbelehrungen regelmäßig anwaltlich prüfen – auch kleine Formulierungsfehler können große wirtschaftliche Folgen haben.
Fazit aus unserer Sicht:
Das Urteil des OLG Stuttgart belegt einmal mehr: Im Onlinehandel ist die rechtssichere Gestaltung der Widerrufsbelehrung keine Formsache, sondern geschäftskritisch. Selbst ein minimaler Formulierungsfehler kann fatale Folgen haben – insbesondere dann, wenn es nicht um einen Wasserkocher, sondern um ein 65.000-Euro-Elektroauto geht.
Gleichzeitig erinnert das Urteil Händler daran, dass trotz Wegfall des Wertersatzes im Fall einer fehlerhaften Belehrung noch Handlungsoptionen bestehen – nämlich dann, wenn der Kunde seine Obhutspflichten grob verletzt.
Unser Tipp: Investieren Sie in eine korrekte Widerrufsgestaltung als regelmäßig in den unnötigen Verlust von Wertersatz – sowohl kurz- als auch langfristig eine sehr lohnende Investition.
Sie wollen wissen, ob Ihre Widerrufsbelehrung auch wirklich rechtssicher ist oder ob Ihre AGB unnötige Lücken enthalten?
Sprechen Sie uns an – wir helfe Ihnen, Ihr E-Commerce-Business auf der sicheren Seite zu halten.